"Der könnte ein Genie werden, er komponiert immer so verrückt".
Alban Berg über seinen Schüler Herschkowitz
Der Komponist Philip Herschkowitz gehört zu den grossen Unbekannten des 20. Jahrhunderts. Der gebürtige Rumäne hatte in den 30er Jahren in Wien bei Berg und Webern studiert, flüchtete als Jude nach dem Anschluss Österreichs nach Rumänien und fand sich nach dem Krieg in der Sowjetunion wieder, wo er Privatstunden erteilte, komponierte und musiktheoretische Schriften verfasste. Erst 1987 wurde ihm die Ausreise nach Wien gewährt, wo er zwei Jahre später starb.
Am 26. Februar führten der Pianist Tomas Bächli und die Sopranistin Eva Nievergelt im Ballhaus Naunynstraße in Berlin Werke von ihm auf, darunter zwei Uraufführungen. Zusammen mit Lena Herschkowitz, der Witwe des Komponisten, hat der in Berlin lebende Komponist Klaus Linder im Selbstverlag 1997 den Band "Philiph Herschkowitz über Musik" herausgegeben und sich über viele Jahre mit dessen Kompositionen befasst (am 27. Februar wurde sein Klavierstück "Summen" im Ballhaus Naunynstraße uraufgeführt). Im Gespräch mit dem Pianisten Tomas Bächli gibt er Auskunft über seine Recherchen zu Heschkowitz.
Wie bist du auf die Musik von Philip Herschkowitz gestossen?
Als ich dreizehn Jahre alt war, hatte ich einen 16-jährigen Freund, der mich mit Werken von Schönberg, Webern und Berg bekannt gemacht hat. Er spielte mir auf dem Klavier Schönbergs Opus 11 und Opus 19 vor. Das hat meine Vorstellung von Musik aufregend verändert. Ich versuchte dann, alles über diese Komponisten zu finden, und in einer Monographie über Webern traf ich auch auf ein Foto von Herschkowitz, der ja Schüler von Webern war. Viel später, anfang der 1990erjahre, fand ich im Katalog eines russischen Antiquariats ein Buch mit dem Titel "Filip Gerschkovitsch: O muzyke" (Philip Herschkowitz: Über Musik). Es war der erste Band seiner russischen Schriften, die von seiner Witwe Lena Herschkowitz in Moskau herausgegeben wurden. Das Buch war im Selbstverlag hergestellt und eine Photographie des Autors von Hand auf den Buchdeckel aufgeklebt.
Du hast mit Lena Herschkowitz 1997 die deutschen Schriften von Herschkowitz herausgegeben. Wie entwickelte sich deine Beziehung zu ihr?
Den ersten, indirekten, Kontakt zwischen uns stellte der Komponist Alexander Wustin her. Lena Herschkowitz lebte damals abwechselnd in Wien und Moskau. Sie mußte jedes Jahr wieder ein Visum beantragen. Herschkowitz' Wunsch, nach Wien zurückzukehren, ging erst 1987, zwei Jahre vor seinem Tod, in Erfüllung, und die beiden konnten schießlich in einer Wohnung von Alma Zsolnay, der Enkelin von Mahler, umsonst wohnen. In Moskau traf man ständig Leute, die Herschkowitz gekannt hatten und angeblich mit ihm befreundet gewesen waren, aber unter der Bewunderung war häufig auch eine ambivalente Haltung zu spüren. Herschkowitz hatte gegenüber der jüngeren Komponistengeneration um Schnittke und Denissow größte Vorbehalte, verständlicherweise. Daß die Situation um Herschkowitz durch eine Vielzahl persönlicher Empfindlichkeiten kompliziert wurde, war mir schnell klar geworden. So schlug ich Lena Herschkowitz vor, dass wir uns doch erst einmal in Wien auf die Suche machen könnten nach dem, was Herschkowitz dort bei seiner Emigration im September 1939 hinterlassen hatte.
Unter welchen Umständen war Herschkowitz emigriert?
Er war eigentlich nicht emigriert, sondern in sein Geburtsland Rumänien zurückgekehrt - obwohl er Wien immer als seine eigentliche Heimat ansah. Nach der Annektion Ästerreichs durch die Nazis musste Herschkowitz als Jude ständig damit rechnen, deportiert zu werden. Weil sein Heimatland jedoch damals auch schon eine antisemitische, profaschistische Regierung hatte, wurde ihm dort die Einreise verweigert. So lebte er die letzten anderthalb Jahre in Wien versteckt - aber er ging jede Woche zu Webern in den Kompositionsunterricht, bis sich im September 1939 endlich die Möglichkeit bot, doch nach Rumänien zu fliehen. Er packte alles, was ihm wichtig war, in zwei grosse Koffer, die er einem Freund, dem Webern-Schüler Emil Spira zur Aufbewahrung überliess - "erst mal", wie er dachte. Spira emigrierte nach London und liess die Koffer bei seinen Eltern. Diese wurden wahrscheinlich in ein Konzentrationslager deportiert und ermordet. Von den Koffern, die alles enthielten, was Herschkowitz vor 1939 komponiert hatte, fehlt bis jetzt jede Spur.
Was wusste Lena Herschkowitz über die Wiener Zeit ihres Mannes?
Das anzusprechen war heikel. Herschkowitz zeigte ihr zwar Wien und erzählte von früher, aber weil Spiras Eltern ermordet worden waren, weigerte er sich, an Dinge zu rühren, die er ein für alle Mal verloren gegeben hatte. Es brauchte einige Überredung, bis Lena bereit war, nach jenem Herschkowitz zu forschen, den es gab, als sie noch nicht einmal geboren war. Dann jedoch verwandelte sie sich in eine sehr geschickte und hartnäckige Forscherin. Wir riefen alle Spiras an, die wir im Wiener Telefonbuch fanden, aber es waren keine Verwandten von Emil Spira dabei. Dann suchten wir in den Bibliotheken und Archiven - und im Nachlass von Alban Berg fanden wir dann die Briefe an Berg sowie zwei Kompositionen: die "Fuge für Kammerorchester" und das Lied "Wie des Mondes Abbild zittert", das zwischen den Seiten einer Violinschule lag, wo es bisher offenbar übersehen worden war. Ich kann nicht an Herschkowitz denken ohne das Gefühl, dass uns darüber hinaus unglaublich wertvolle Werke verloren gegangen sind.
Wann begann Herschkowitz nach dem Krieg wieder zu komponieren?
Es gibt eine riesige Lücke, mehr als ein Vierteljahrhundert, wo wir keine Dokumente seines Komponierens haben. Erst aus den Sechzigerjahren gibt es wieder Kompositionen. Abgesehen von einem seltsamen Findling: dem Klavierstück "Frühlingsblumen", das 1947 entstanden ist; es umfasst nur eine Seite, die neben unvollendeten Skizzen aufbewahrt wurde. Es deutet darauf hin, dass sich Herschkowitz nach dem Ende des Kriegs Hoffnungen machte, auf ein normales Leben, auf die Möglichkeit, wieder zu komponieren. Doch dann wurde er in der Sowjetunion gleich aus dem Komponistenverband ausgeschlossen. Bald nach dem Krieg begannen antisemitische Kampagnen Stalins, Herschkowitz war akut gefährdet. Was ihn in den Fünfzigerjahren rettete, waren Kontakte zu Musikern, die ihm Privatschüler verschafften. Und Herschkowitz fand einen Weg, nicht Schönberg oder Webern zu unterrichten - sondern Beethoven, allerdings mit Weberns Lehre der musikalischen Form im Kopf. Doch mit Komponieren begann er vielleicht erst wieder in den Sechzigerjahren. In einem Brief an Bruno Kreisky schrieb er, etwa um die Mitte der Fünfzigerjahre sei er "wieder zu sich gekommen".
Herschkowitz schrieb fast ausschliesslich 12-Tonmusik. Er war einerseits sehr vorsichtig. In Wien noch bestand er darauf, gewisse Gespräche nur auf freiem Feld zu führen, wo keine Gefahr des Abgehörtwerdens bestand.
Was für Kompositionen entstanden nach dieser langen Pause?
Es ging womöglich gleich los mit den vier Celan-Liedern, die in einer absoluten Sicherheit hingeworfen sind. Herschkowitz schrieb fast ausschliesslich 12-Tonmusik. Er war einerseits sehr vorsichtig. In Wien noch bestand er darauf, gewisse Gespräche nur auf freiem Feld zu führen, wo keine Gefahr des Abgehörtwerdens bestand. Und doch war er auch unvorsichtig und sehr "geradeheraus". Er hat kritische Sachen gesagt, die denjenigen, die sie gesagt bekamen, noch Jahrzehnte später in Erinnerung blieben. Überhaupt nicht vorsichtig war er in seinen Kompositionen. In den Celan-Liedern hat er die Texte mit einer unbefangenen Direktheit vertont, sodass sich diese Gedichte entfalten können ohne von einer manierierten Musik zugedeckt zu werden, wie es in anderen Celan-Vertonungen nicht selten der Fall ist. Seine Orchesterlieder sind von ungeheurer Schönheit, und hier zeigt sich auch, was für ein imaginativer Instrumentator Herschkowitz war. Er hat übrigens in den Fünfzigerjahren in Moskau zeitweise durch das Instrumentieren von Filmmusik überlebt.
Worin besteht denn die besondere Qualität von Herschkowitz' Musik?
Der Dichter Soma Morgenstern hat nach dem II. Weltkrieg in seinen Briefen eine Aussage von Alban Berg über seinen Schüler Herschkowitz zitiert: "Der könnte ein Genie werden, er komponiert immer so verrückt". Wenn man das Lied "Wie des Mondes Abbild zittert" aus dem Jahr 1932 hört - also aus der Zeit, als Berg dies sagte -, merkt man, dass in dieser Komposition wirklich etwas Verrücktes ist. Für die Werke, die in der Sowjetunion entstanden sind, gilt das erst recht. Man versteht nicht sogleich, woher ihre starke Wirkung kommt, denn extravagante Merkmale springen zunächst nicht hervor. Herschkowitz schreibt zum Beispiel häufige Akkorde: dunkle Zusammenballungen von Tönen, die über gleichmässige Achtel verteilt werden. Der Rhythmus wird jedoch nicht vorherrschend, vielmehr scheinen diese Akkorde etwas zu haben, was in einem einzelnen Achtel zusammengeprallt ist. Den Ton-Energien nach kommt es von irgendwoher und geht nach irgendwohin - etwas, was man durch einen einzelnen Achtelanschlag nicht darstellen könnte. Auch dort, wo die Musik einfachen Strukturen zu folgen scheint, wird nie etwas zweimal gesagt. Die späten Orchesterlieder haben etwas geradezu unfreiwillig Unkonventionelles. So verwendet Herschkowitz etwa in seinem letzten Lied "Brume" (nach Guillaume Apollinaire) plötzlich zwölf Solo-Violinen. Solche "unökonomischen" Dinge erschweren es natürlich, diese Musik zur Aufführung zu bringen. Ihm konnte das egal sein, er wurde ohnehin nicht aufgeführt.
Warum wird Herschkowitz auch heute noch nicht aufgeführt?
Die Zeit ist wohl vorbei, als Kulturämter in größerem Rahmen Konzerte mit Musikern förderten, die von den Nazis verfolgt wurden. Doch es ist eher Gleichgültigkeit als ein Widerstand gegen diese Musik, die ja noch kaum jemand gehört hat. Als ich dem damaligen Geschäftsführer der "Universal Edition" 1995 die Noten von Herschkowitz anbot, lösten diese Partituren in ihm offenbar nicht die gleiche Erregung aus wie in mir. Er sagte: "Vor jede gute Tat hat der liebe Gott die Kalkulation gestellt" und entließ mich freundlich. Hatte er etwas gegen Herschkowitz' Musik? Nein. Er hatte weder etwas dafür noch dagegen. Er konnte sie sich nicht vorstellen. Aber ich bin zuversichtlich. Wenn die Musik erst einmal aufgeführt wird, findet sie ihren Weg.
Wie komponierst Du selbst?
Ich habe oft das Gefühl, dass sich Sachen zueinander fügen, die ich mir nicht erst in diesem Moment ausgedacht habe. Ich versuche, mich zu überlisten, indem ich einen Plan aufstelle - der aber noch in keine Komposition so eingegangen ist. Wenn ich komponiere werden Zahlen wichtig - sowohl die Verbindbarkeit der Zahlen als auch der unverwechselbare Charakter jeder einzelnen Zahl. Ihr Wachsen und Schrumpfen und der Raum, in dem das geschieht. Ich versuche, mir ein Netz zu bilden, mit dem ich in meinem inneren Bereich Dinge hervorhole, die in einer Art Intimität zu existieren scheinen.
Du hast eine grosse Affinität zur 12-Tonmusik - verwendest du diese Methode auch bei deinen eigenen Kompositionen?
Eine 12-Tonreihe befriedigt auch mein Ohr mehr als eine 7-Tonreihe, in der gewisse Intervallkonstellationen fehlen. Ich möchte, dass das Wachsen oder das Schrumpfen von Intervallen schon in der Grundlage ausgedrückt ist. Bei einem Stück, das im Halbtonsystem geschrieben ist, verschränke ich zwei verschiedene All-Intervallreihen ineinander, bei einem Stück in Vierteltönen sind es vier, bei Achteltönen acht usw. Ich überlagere jetzt mehr. Andererseits kann ich dafür auch immer mehr Anderes weglassen. Manchmal muss ich lange arbeiten, bis Resultate herauskommen, die ich akzeptieren kann. Ich kann mir kein Kunstwerk vorstellen, in dem es nicht irgendeine Art von Berührungstabu gibt. In einem Kontinuum reicht eine winzige Einkerbung oder Spur. Sie unterteilt, bildlich gesprochen, den Raum in links von der Einkerbung und rechts von der Einkerbung. Ich arbeite mit winzigen Spuren, denn wenn die Vorstellung sich mit dem Raum, der Zeit und den Toneigenschaften verbindet, reichen sehr kleine Ursachen, um genug Wirkung herzustellen. Wobei ich sehr dringlich das Gefühl habe, daß die Begriffe "Ursache" und "Wirkung" zwar sehr wichtig für die Musik sind, daß die Musik aber zugleich nur so tut, als gäbe es sie.
Du hast das Komponieren bei Juan Allende-Blin gelernt, wie du selbst sagst. Und doch haben eure Werke kaum Ähnlichkeiten miteinander.
Juan Allende-Blin ist selbstverständlich ein anderer Komponist als ich. Von ihm habe ich gelernt, musikalische Zeiträume zu proportionieren - um das vielleicht Auffälligste zu nennen. Juan Allende-Blin ist ein unglaublich produktiver Komponist und imstande, so etwas wie ein inneres Drama in Tönen darzustellen. Er komponiert für mein Gefühl, obwohl das keine erschöpfende Beschreibung ist, sogar nur mit wenigen Tönen und Akzenten so, wie ein großer Romancier seine Werke bauen könnte: die Töne scheinen in ungeheuer spannungsreiche Handlungen miteinander zu geraten, in denen sie fast wie Personen auftreten - ein wahrhaft langer Atem. Außerdem habe ich bei Juan Allende-Blin, obwohl er die Gewissenhaftigkeit in Person ist, einen gewissen Je-m'en-foutisme gegenüber dem umgebenden Musikleben gelernt. Wirklich befreiend.


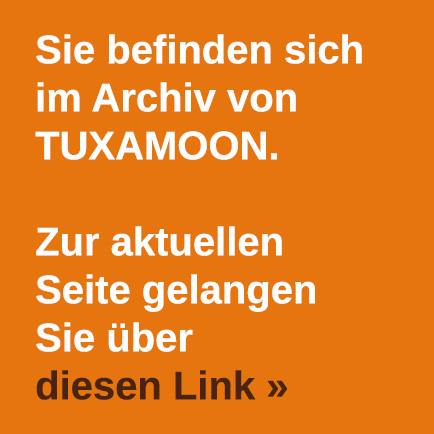
 it!
it!