Möglicherweise ist es gerade das, was man sucht, kein zugrunde liegendes allgemeines Konzept [...]
Der erste Eindruck die Haupthalle im Erdgeschoss mit der 400 qm großen geteerten Fläche von Ahmet Öğüt, Ground Control an den Wänden Leere, weiße Fläche, der Straßenasphalt dominiert. Ein Affront sicherlich an den Kunst-Suchenden, doch irgendwie tut diese Leere, dieser asketische Purismus auch gut und macht Platz für die kommenden Eindrücke.
Ein halbes Stockwerk darunter in einem fensterlosen Kellerraum, die Installation Fregatte von Jos de Gruyters und Harald Thys, ein beklemmender Videofilm. Im Mittelpunkt eines Raumes steht das düstere ganz in grau-schwarz gehaltene Modell einer Fregatte auf einer Art Sockel, eine Gruppe von finster dreinschauenden Männern schart sich um dieses Objekt der Begierde und betrachtet sich gegenseitig mit Missgunst und Misstrauen. Die Kamera verharrt in extrem langen, geradezu standbildhaften Einstellungen auf den Gesichtern, - aber der Film läuft, es sind ab und an allerkleinste Regungen im Gesicht, minimale Veränderungen der Körperhaltung zu erkennen - und wandert dann weiter zur nächsten Person. Das Ganze erinnert etwas an die alte flämische Portraitmalerei eines Jan van Eyck. Danach wird die Gruppe ins Visier genommen, man sieht sie in aggressiven, abweisenden Körperhaltungen und Gesten zueinander verhalten. Sie bedrängen mit Drohgebärden einen mit einem karierten Hosenrock und hellblauen Pullover gekleideten Außenseiter, eine Frau vermutlich, so ganz klar ist das nicht zu erkennen. Zum Schluss ein eher aus der Welt des Bilderbuches bekanntes Spiel: Vor einem vertikal drei geteilten Spiegel werden Kopf, Rumpf und Beine unterschiedlicher Personen (und einer Pflanze!) jeweils vertauscht und neu kombiniert, eine physiognomische Studie. Extrem langsame Kamerafahrten, die teilweise unterlegte Orgelmusik beschwören eine unheilschwangere Stimmung herauf, erzeugen klaustrophobisch erdrückende Enge, und das in einem dunklen Kellerraum.
Im 1. Stock wird die Situation etwas heiterer. Beeindruckend die Installation von Kateřina Šedá ‚Over and over’. Auffallend ist der Kontrast zwischen dem Thema, mit dem sich Kateřina Šedá laut Katalog beschäftigt, die Überwindung von Zäunen, Mauern, Abgrenzungen, die sich in ihrer Heimatstadt Lisen in Tschechien aufgebaut haben und dem, was der Besucher dann zu sehen bekommt. Ein ausgesprochen dekorativ gestalteter Raum mit einem detailverliebten Arrangement von aus Pappe und Papier ‚gebastelten’ Objekten, deren Anordnung einfach schön anzuschauen ist. Sie arbeitet gerne mit Spiralblöcken und -heften, die sie zu Leporellos verbindet, oder aber von einem in der Mitte liegenden achtkantigen Block von dem an jeder Seite wiederum weitere Blöcke durch Spiralen verbunden sich anschließen. Die Versuchung ist groß, die Blöcke zuzuklappen und wieder aufzuschlagen. Ein wenig erinnert das alles an einen Schreibwarenladen für den gehobenen Bedarf oder einen wohlgestalteten Klassenraum für Graphik und Design. Drei überdimensionierte silberfarbene Schlüssel hängen an der Wand. Dies ist eine der wenigen erkennbaren Verbindungen zu dem Ausgangsthema und ihrer Installation im Skulpturenpark Berlin_Zentrum, wo sie in kreisförmiger Anordnung eine Auswahl von Zäunen und Mauern ihrer Heimatstadt nachgebaut hat, inklusive diverser Trennwände überwindender Hilfsmittel, wie Leitern und Stühle. Die Installation im Skulpturenpark macht Spaß, und sie passt genau an den Ort in Berlin, einem Stück Brachland auf dem ehemaligen Mauerstreifen umgeben von blendend weißen, neu erbauten Mietshäusern.
- Seda, "Over and Over", Foto: Eva Sietzen
Weiter zu Ania Molska, Untitled; P = W:T (Power), W = F*S (Work)
Eine Kombination von zwei Videofilmen, die auf zwei über Eck in einem stumpfen Winkel zueinander stehende Wände projiziert werden. Von der Besucherbank aus sieht man beim Betrachten des einen Films den anderen quasi immer aus dem Augenwinkel mit.
P = W:T (Power) spielt in einer Squashhalle. Bälle, die von einer unsichtbaren Kraft bewegt werden, fliegen durch die Luft, rollen auf dem Boden, oftmals steht das Bild auf dem Kopf.
W = F*S (Work) zeigt wie eine Gruppe von Arbeitern anrückt und eine riesige dreieckige Eisenkonstruktion, eine Art Baugerüst, auf schlammigem Untergrund aufbaut. Der Prozess dieses Aufbaus, dieser Konstruktion, ist durchaus faszinierend anzusehen. Am Ende stehen die Arbeiter selbst auf dem Gerüst und bilden mit ihm eine Einheit als lebendige Skulptur. Ganz einleuchtend ist die Korrelation zwischen den beiden Videofilmen nicht, ein verbindendes Element mag die Dreieckskonstruktion sein, die in den Linien auf dem Fußboden der Squashhalle wieder auftaucht, die darauf bewegten Bälle korrespondieren den Menschen, die am Gerüst arbeiten, auf ihm herumklettern. Auf jeden Fall würde einem Film etwas fehlen, wenn der andere nicht daneben herliefe. (Die fertige Konstruktion findet sich im Skulpturenpark und ihr fehlen auf jeden Fall die auf ihr herumlaufenden und an ihr herumwerkelnden Arbeiter)
Die Betrachterin gelangt nun zur nächsten Kammer, in der ein Videokunstwerk gezeigt wird, zu Patrizia Esquivias ‚Folklore’ #1 und #2.
Zu sehen ist ein Arbeitstisch auf dem beschriebene Papiere, Karteikarten, Zeitungsausschnitte, Photos, ständig von Händen hin und her geschoben werden, dazu eine Stimme, die auf ungewohnte Weise die Geschichte Spaniens erzählt, Zusammenhängen von Sonnenschein und spanischer Identität erläutert, indem sie Bezüge zwischen Philipp II. (1527 -98) und Julio Iglesias, dem Schlagersänger, herstellt. Während im 16. Jahrhundert das in Lateinamerika erbeutete Gold die Situation Spaniens bestimmte, und die Sonne zum scheinen brachte, ist es in der Nachkriegsgeschichte die Sonne, die touristische Vermarktung des sonnigen Südens der Strände Spaniens, wie von Julio Iglesias besungen, die das Gold/Geld nach Spanien brachte. Die Aufnahmen der sich ständig verändernden Arrangements der schriftlichen Unterlagen, Materialien und Texte sind hier die Kunst, ein Fluss von kunstvollen Anordnungen zum gesprochenen Wort.
Im zweiten Stock der Kunstwerke gelangen wir zu Babette Mangolte (Now) or Maintenant wieder eine Kombination aus zwei Videofilmen, die über Eck gezeigt werden, dazu an der Wand eine kleine feine Serie von schwarz-weiß Photographien aus den 70er Jahren, motion studies. In der Videoarbeit ‚Now’ bauen zwei Hände aus Zigarettenschachteln mit der Aufschrift ‚NOW’ wird eine Wand auf, die immer wieder wie ein Kartenhaus kollabiert. Zunächst sind nur die Hände, die bauen und die Schachteln zu sehen, dann die Frau, immer wieder bricht die Wand zusammen, dann taucht ein Paar andere Hände auf, die helfen beim Wiederaufbau und dann sich gegenseitig ertasten, erforschen und finden. Auf der Wand über Eck im rechten Winkel dazu gibt es ein Video, das die Oberflächenstrukturen und Texturen von Blumen und Kakteen in epischer Breite darstellt.
Hier ist wieder der Bezug der beiden Videofilme zueinander nicht unmittelbar einleuchtend. Jeder für sich alleine würde vielleicht die bessere Wirkung entfalten.
Weiter hinten im Raum eine verstörende Photoserie von Kohei Yoshyuki.
Aufnahmen von Liebespaaren in einem Park in Tokio samt den ihnen nachstellenden Voyeuren. Die Photos sind sehr grobkörnig und blass, sie wurden nachts mit Infrarot-Blitzlicht aufgenommen, die Kamera in einem toten Winkel zu den Akteuren, sodass sie die Aufnahmen nicht bemerkten. Die Kleidung der Beteiligten wirkt einfach, abgetragen, die Szenerie hat oft einen eigentümlichen Zauber des Unvollkommenen, ‚Realen’, der sich wohltuend von der Perfektion der Kino- oder Fernsehbilder absetzt, die unsere Sehgewohnheiten zu diesem Thema dominieren. Der Betrachter sieht sich dem Sog der 54 Aufnahmen ausgesetzt und zum Schluss unfreiwillig selbst als Voyeur.
Ganz oben schließlich, im Dachgeschoss der Kunst-Werke, das Studio A von Tris Vonna-Michell. Vielleicht einer der am besten durchgestalteten Räume, obwohl das Thema dazu wieder in einem eigentümlich disparaten Verhältnis steht. Es geht um den Niedergang der einst expandierenden Metropole und Autostadt Detroit. Die Filmindustrie vermarktete diese Stadt mit ihren Leerstands- und Kriminalitätsphantasien als virtuellen Schauplatz für RoboCop-Filme. Detroit wurde zur Ikone der Hoffnungslosigkeit. Inzwischen sind diese RoboCop Videos bereits wieder entsorgt und finden sich - im Unterbewusstsein des kulturellen Gedächtnisses - inmitten vergessener Objekte in Charity Shops. Der Raum, den Vonna-Michell ganz für sich und ihr Projekt nutzen kann, ist grandios durchkomponiert. Mit Hilfe eines alten Diaprojektors werden Aufnahmen von Details der verlassenen Stadtteile, Gebäude, Stadtansichten vorgeführt. An einer anderen Seite des Raumes findet sich das unentwirrbare Geflecht einer Stadtautobahn auf eine unebene Fläche projiziert. Mehrere Trennwände mit Fenstern stehen im Raum, teilen ihn auf, deuten wie in einem Studio, Wohnungen an. Man fühlt sich wie in einem weitgehend unbewohnten, verlassenen Haus, einige wenige Einrichtungsgegenstände, Stühle und Tische stehen noch da, - wohl zurückgelassen von den früheren Bewohnern. Es ist dämmerig. Das Licht wurde wohl schon ausgeknipst. Die einzigen Lichtquellen sind die von den verschiedenen Beamern projizierten Photos. Dennoch werden so ästhetisch höchst faszinierende Durchblicke, Perspektiven ermöglicht, auf eine scheinbare Außenwelt, wie das der Stadtautobahn. Der Ausstellungsführer spricht von einem „urbanen Psychogramm“. Im Dachgeschoss des KW-Instituts, einst ein Produktionsort für Margarine, spannt Vonna-Michell „ein dichtes Netz aus Stadtimaginationen, das eng an die Produktions- und Deproduktionszyklen des Materiellen und Immateriellen gekoppelt ist.“
Was also bringt uns die Ausstellung außer einem Einblick in die gegenwärtige junge Kunstszene? Gibt es so etwas, wie ein Allgemeines, ein zugrunde liegendes Gemeinsames, das die ausgestellten Kunstwerke verbindet? Schwer zu sagen, die beiden Ausstellungskuratoren Adam Szymcyk und Elena Filipovic jedenfalls haben in diversen Interviews stets betont, im eigentlichen Sinne kein Konzept verfolgt zu haben. Interessant ist trotzdem, welche Fragen den Ausstellungskuratoren laut Ausstellungskatalog ‚keine Ruhe ließen’:
„Auf welche Weise spricht ein Kunstwerk über eine bestimmte Sache? Wie kann das Kunstwerk gleichzeitig eine Vielzahl anderer Themen ansprechen? Wie können Inhalt und Form, das Politische und das Private, historische Verweise und gegenwärtige Realität einander derart unauflösbar durchdringen, dass dabei so etwas wie ein Kunstwerk entsteht? (...) Wäre es nicht eine reduktionistische Formalisierung, eine künstlerische Arbeit lediglich im Hinblick darauf zu betrachten, inwieweit sie einer festgelegten kuratorischen Agenda entspricht, sollte diese auch noch so „korrekt“ sein, und im Hinblick auf diese Agenda die „richtige“ Deutung der Form des Kunstwerks, seinen ästhetischen Inhalt und seine politische Aussage zu bestimmen? Berechtigt jedes übergreifende Thema, jede Kategorie dazu, eine bestimmte Arbeit in das Programm einer Biennale aufzunehmen, oder handelt es sich dabei in der Hauptsache bloß um ein Alibi zur Sicherung der Erhabenheit des Kurators über das durch eine Ausstellung erzeugte Bedeutungsgewirr?“
Möglicherweise ist es gerade das, was man sucht, kein zugrunde liegendes allgemeines Konzept, sondern das Angesprochen-Werden von der Rätselhaftigkeit des Dings, das man Kunstwerk nennt. Dieter Roelstraete hat in seinem Vortrag ‚Die Nacht der Dinge’ während einer Abendveranstaltung der Berlinbiennale Die Fregatte von Jos de Gruyter und Harald Thys als das Beispiel par excellence für den enigmatischen Charakter der Dinge vorgestellt, das ein Kunstwerk ausmacht. ‚Wir gehen in Kunstausstellungen, um Dinge zu sehen, die wir nicht verstehen. Wir werden angezogen davon, dass wir sie nicht verstehen.’


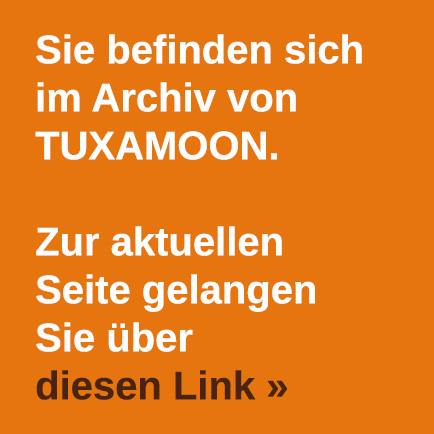
 it!
it!