Sailor: i cant follow the story
Agatha: its your problem
trust-n-dust diary
Die Geschichte von Agatha ist schnell erzählt: Ein arbeitsloser Computerspezialist, der wichtige Systemdokumente veruntreut hat, trifft auf eine Schönheit aus der Provinz.(www.c3.hu/collection/agatha/). Die schöne Agatha will aus der Enge ihrer Heimatstadt in das Grosstadtleben aufbrechen und ist empfänglich für Ratschläge. Der Spezialist lotst Agatha in seine Wohnung, um sie zu verführen. Doch das gelingt ihm nicht. Nicht er becirct Agatha, sondern das Wissen über die Welt des Internets, das er ausplaudert, verführt Agatha und sie begibt sich in das Netz. Der Clou dieser Story liegt in der Präsentation. Die Russin Olia Lialina präsentiert die Geschichte mit den Mitteln des Mediums Internets. Vor einem schwarzen Hintergrund sieht man die Figuren einander näher rücken. Statt Sprechblasen informieren die Statuszeilen des Programmfensters über die sprachlichen Verführungsversuche. Dort wo sonst zu lesen ist, das der Computer noch 5 Sekunden benötigt, um die Seite zu laden, liest man nun: „I’m lost...“. Schon auf dieser Ebene zeigt die Arbeit von Olia Lialina zwei Besonderheiten der Netzkunst. Die Netzkunst ist eine Zwischenform, nicht Kino, nicht Fotoroman, nicht Comic, sondern alles zugleich und das unter den erschwerten Bedingungen, dass die Übertragung der Bilder schleppend ist. Sie ist nicht wie beim heutigen Kino oder Video durch einen stabilen Mechanismus reguliert, noch kann der Nutzer wie ein Leser oder Betrachter von Comics autonom die Seiten wechseln. Der Rhythmus der Betrachtung hängt von der Geschwindigkeit des Computers und von der Qualität der Internetverbindung ab und gerade diese schwankt nach je nach Tageszeit und Verkehr auf den Datenstrassen.Hinter diesen Details verbirgt Lialinas Geschichte vom armen Provinzmädchen Einsichten in die Möglichkeiten des Internets. Das entscheidende Detail ist im Adressen-Fenster zu finden, dem Teil des Programmfensters, das angibt, von welchem Server die Internetseite geladen wird. Verfolgt man nämlich geduldig Agathas Geschichte, dann entdeckt man, dass sie eigentlich ein unendliches Fragment ist. Anfangs werden die Seiten von einem Server in Budapest heruntergeladen, aber in dem Momente, in dem sich Agatha verabschiedet, kommen die Seiten von Servern aus aller Welt. Auf dem Computerschirm bleibt Agathas unschuldiges visuelles Konterfei unverändert. In der Adresszeile sind Hinweise auf Computer in aller Welt zu finden. Lialina hat ihr bekannte Systemadministratoren und Netzkünstler gebeten, Adressen zur Verfügung zu stellen und so kann man sehen, dass Agatha in Datensammlungen mit bizarren Namen wie www.zuper.com, www.easylife.org ,www.irational.org oder www.superbad.com Spuren hinterlassen hat. Agatha scheint es im Netz nicht zu behagen, denn eine der letzten Mitteilungen lautet: „...möchte nach Hause“. Das Versprechen des anonymen Verführers, der Agatha mit den Worten entlässt „Um das Netz zu verstehen, musst Du im Netz leben“ zeigt bei Agatha keine Wirkung, sondern weckt Sehnsucht nach der Provinz. Ihr Schiksal bleibt dem Betrachter unbekannt. Er weiss nicht, ob alle Seiten, auf denen die Künstlerin Agathas Daten hinterlassen hat, aufrufbar sind.
Mit der Unsicherheit kann die Autorin und Netzkünstlerin Lialina gut leben. Für sie besteht der Reiz der Internetkunst in der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Zusammenarbeit bedeutet, dass sie sich weltweit über Programme informiert und Kenntnisse mitteilt, aber auch Speicherplatz zur Verfügung stellt oder von anderen nutzt. Leben kann man von dieser Kunst nur, wenn man ein FNA ist. FNA bedeutet Famous Net artist und das heisst, dass man auf Konferenzen eingeladen wird und dafür honoriert wird. Ein gewöhnlicher Net artist bleibt anonym und muss sein finanzielles Auskommen anderweitig verdienen, als Gestalter oder als Systemverwalter, der nicht nur in der Geschichte von Agatha ein anonymes Dasein fristet. Der englische Künstler Heith Bunting ist ein berühmter Netzkünstler. Er teilt die Einsicht, dass man von der Netzkunst eigentlich nicht leben kann und hat vorgeschlagen, dass man die Netzkünstler ihre Werke den Kunst-Museen schenken. Museumsdirektoren und Kulturpolitiker sollten sich nicht zu früh über diese Freizügigkeit freuen und sich aus der Verantwortung für die Kunst mit dem Internet stehlen. Denn die künstlerische Arbeit ist ein gewichtiger Faktor in zukünftiger Standortpolitik, die zunehmend mit Informationen handelt und dringend auf Inhalte angewiesen ist. Verpasst man jetzt die Chance, Netzkuenstlerinnen zu fördern, wird ähnliches wie in der Fernseh-Industrie zu befürchten sein, nämlich, dass man eilig Drehbuchautoren in schnell gepflanzten Schreibschulen aufziehen muss, um dem Bedarf gerecht zu werden. Die Förderung von Netzkunst kann nur bedingt durch Wettbewerbe und Preise geschehen. Zwar zeigt der gegenwärtige Kurzfilm-Wettbewerb des Fernsehsenders arte, dass ein Potential von Kurzfilmern in Frankreich und Deutschland vorhanden ist.
Die Jury hat Arbeiten besonders hervorgehoben, die mit der Instabiltät des Internets rechnen und die ökonomisch mit den Datenmengen umgehen. Abstrakte und schlichte Bilder sind im Internet besonders gefragt, da konturenreiche Bilder hohe Datenmengen verschlingen und damit die Übertragung verlangsamen und den Sehgenuss durch Wartezeiten versauern, aber auch unökologisch den Datenverkehr belasten. Der erste Preis (2500 EUR)wurde verliehen an Stéphanie Heendrickxen. Die Arbeit von Heendrickxen, „Moi, moi-meme et le clones“ präsentiert eine Folge von Einzelbildern, die auch dann das Auge beschäftigen, wenn die Aufeinanderfolge der Bilder gestört ist. Jedes Bild ist eine Entdeckung. Das gilt ebenso für die Arbeit „Decodel“ von Susanne Huth und Kai Dankel. Sie wurde mit dem zweiten Preis (2000 EUR) ausgezeichnet wird. Die besondere Qualität von „Decode“ besteht im verblüffenden Wechsel des Bildgedankens, in einer unerwarteten Wende, die keiner narrativen Vermittlung bedarf. Ikastisch würde Italo Calvino einen solchen Bildwechsel nennen, weil sie dem Betrachter mit wenigen exakt eingesetzten Zeichen einen visuellen Gedanken vermitteln.
Den Sonderpreis der Jury erhielt (Ausstrahlung im Kurzfilmmagazin von arte):
Clonateyourbook von Massimo Colella. „Clonatate your book“ verbindet Metaphern der elektronischen Buchkultur mit Begriffen der Genforschung. Die klare dramaturgische Gestaltung verdient eine besondere Erwähnung.
Die Filme „Chat“ von Ludovic Rivalan und „Carl“ von Sébastien Dove erhaltenten weitere besondere Erwähnungen Sie heben sich durch einen originellen Plot oder durch Ironie von den zahlreichen anderen Arbeiten hervor, die sich entweder bekannter erzählerischer Muster bedienen, auch zuviel mit beschränkten Mittel zum Ausdruck bringen möchten oder schlicht visuelle Regelmässigkeiten erzeugen, die vielleicht als Bildschirmschoner taugen, aber nicht der Auseinandersetzung und Aneignung einer neuen medialen Form.
Kurzfilme, die im Internet zu sehen sind, können zur Netzkunst beitragen, nutzen aber die Möglichkeiten des Mediums nur gering. Ein Medium ist das Internet nicht deshalb weil es die Übertragung von Botschaften ermöglicht, sondern weil es eine Umgebung definiert, in der Menschen miteinander handeln. Michal Dertouzos ist Leiter des Informatik-Labors an der amerikanischen Zukunftschmiede, dem MIT. Er vergleicht das Internet mit einem südländischen Marktplatz. Das Wesen des griechischen und römischen Marktplatzes erschöpfte sich in der Antike jedoch nicht im Handel, sondern im steten Gespräch über die Zukunft der Stadt und ihrer Bürger. Wird das Internet auf einen Handelsplatz reduziert, dann ist der Traum von einem zukunftsträchtigen Medium bald zuende und damit wird auch der Marktplatz schnell veröden, da es nur normierte Ware geben wird, die man effizienter im Supermarkt erwirbt.
Der Netzaktivist Geert Lovink hat in einem Beitrag für die Zeitschrift „Du“ ausgeführt, dass die aktuelle wirtschaftliche Boom Amsterdams von Computer-Künstlern und Hackern vorbereitet wurde. Sie haben dafür gesorgt, dass Amsterdamer Bürger Internetadressen erhielten und so früh eine öffentliche Akzeptanz des Mediums geschaffen. Von Hackern sind die Autoren von Netzfilmen weit entfernt. Netzfilmer verwenden standardisierte Software und Programme, die meistens nicht in Europa entwickelt wurden. Hacker hingegen schreiben die Programme selbst oder passen existierende Software ihren Bedürfnissen an. Diese Fähigkeit wird in der zukünftigen Entwicklung der europäischen Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielen. Denn vergleicht man die Entwicklung der Interkunst mit dem Entstehen einer neuen Sprache, dann verfügen die Autoren von Netzfilmen zwar über Ideen, aber nicht über eigene Stimmbänder und organische Werkzeuge, mit denen sie ihre Ideen ausdrücken und modulieren können. Ein Programmierer hingegen verfügt über eigene Stimmbänder und kann die Sprache mitgestalten. Der Hamburger Kunstverein startete im Herbst 2000 das Projekt „Aussendienst“. Es zielte genau auf das Ungleichgewicht zwischen Software-Anwendung und -Entwicklung. Die Künstergruppe „Knowbotic Reserach“ entwickelte für den „Aussendienst“ die Arbeit „Crack it“ (http://io.khm.de/cfa/) und verteilte grosszügig CD’s, auf denen eine eigens entwickelte Software gespeichert war. Wer diese Software auf seinen Rechner herunterlud, erkannte sehr schnell, dass er mit anderen Computernutzern via Internet zusammenarbeiten muss, wenn er das von den Künstlern gesetzte Ziel erreichen wollte. Das bestand darin, in einen Server einzudringen und dort verschlüsselte und eigentlich geheime Informationen einzusehen. Ca. 10.000 Computernutzer haben an diesem Prozess mitgewirkt. Netzkunst in diesem Sinne ist nicht Arbeit an den Oberflächen der Bildschirme, sondern Gestaltung von Computerprogrammen und eine Vermehrung von symbolischer Kompetenz. Das beginnt mit der Einsicht, dass Programme nicht nur kostenpflichtige Pakete sind, die man aus Internet herunterlädt, sondern ein allgemeines Gut, das jeder verändern darf, der es benutzt. Was für die menschliche Rede und Schrift selbstverständlich ist, das ist auf dem Informationsmarkt Internet noch nicht recht und billig. Die deutsche Sprachkultur profitierte erheblich von der Experimentierfreude der barocken Dichter und Juristen, die selbstverständlich Grammatik und Wortschatz ihrer Muttersprachen modulierten. Wer Software moduliert, kopiert und clont, der macht sich häufig noch strafbar. Es ist Sache der Netzkunst, die Grammatiken, mit denen Rechner international verbunden sind, zu erforschen und den unterschiedlichen kulturellen Bedürfnissen anzupassen. Noch ist ein weiter Weg in der Forschungs- und Kulturpolitik zurückzulegen, bis das Netz ein symbolischer Raum wird, den Bürger und nicht Konsumenten akzeptieren und gestalten. Derzeit kann man die aufgeschlossene Agatha nur schlecht davon überzeugen, dass ein Leben unter den Bedingungen der Netzökonomie besser ist als das Leben in der Provinz.


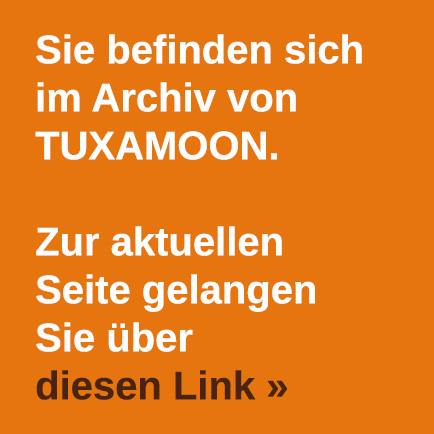
 it!
it!